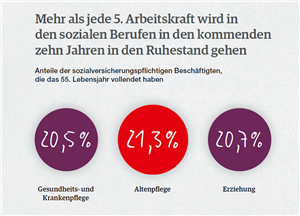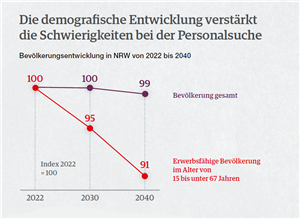Flutkatastrophe 2021: Freiwillige Helfer unterstützen die Anwohner in Erftstadt-Blessem bei den Aufräumarbeiten. Die Caritas leistet finanzielle Soforthilfe und psychologische Unterstützung.Foto: Philipp Spalek | Caritas international
Flutkatastrophe 2021: Freiwillige Helfer unterstützen die Anwohner in Erftstadt-Blessem bei den Aufräumarbeiten. Die Caritas leistet finanzielle Soforthilfe und psychologische Unterstützung.Foto: Philipp Spalek | Caritas international
Es geht im Katastrophenfall zunächst darum, sich ein Bild der konkreten Schadenssituation zu machen. Dazu reicht es oft nicht, die lokalen Medien zu beobachten, sondern die Caritas muss vor Ort mit den Menschen reden und Schäden in Augenschein nehmen. Es ist wichtig, als Caritas von Anfang an sichtbar zu sein. Neben einer entsprechend mit Flammenkreuz versehenen "Berufskleidung" für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt das auch, dass Beratungsstrukturen schnell aufgebaut werden. Im Falle der Fluthilfe war zu beobachten, dass gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sonst andere Beratungen realisieren, von dem großen Andrang Betroffener und Hilfesuchender überrascht und überrollt wurden. Wie könnte ein System aussehen, bei dem Beraterinnen und Berater etwa aus anderen Verbänden des Caritas-Netzwerkes kurzfristig aushelfen? Außerdem sollten Strategien entwickelt werden, im Krisenfall schnell Personal aufzustocken, sofern überhaupt Personal am Markt verfügbar ist.
Koordination des Ehrenamtes
Im Katastrophenfall entsteht meist spontane Solidarität, viele Menschen, die mit anpacken und ganz konkret helfen wollen. Dazu braucht es ein kluges Ehrenamtsmanagement. Im Ahrtal haben sich private Organisationen hervorgetan, die sehr effektiv und sehr schnell Strukturen aufgebaut haben, um auch vielen ehrenamtlichen Helfern die Arbeit zu ermöglichen (siehe auch den Bericht "Wenn wir es nicht machen, macht es keiner"). Dabei stand ebenso immer das gemeinsame Erleben im Vordergrund, was für viele Helfer sicher auch ein Antrieb war. Es könnte lohnend sein, über kreative Beteiligungsmöglichkeiten nachzudenken, um auch logistisch herausfordernden Situationen zu begegnen, wenn plötzlich viele Freiwillige an die Tür klopfen und helfen wollen.
Spendenaufrufe
Es ist wichtig, gerade in der Akutphase Gelder zu mobilisieren. Sollten sich Katastrophen häufen, ist nicht abzusehen, wie sich die Spendenbereitschaft der Menschen entwickelt. Es wäre gut, wenn Spenden weniger zweckgebunden eingenommen werden könnten und z. B. in einen allgemeineren Spendenpool fließen könnten, der für Not- und Katastrophenhilfe vorgesehen ist. Aufrufe könnten entsprechend gestaltet und formuliert werden. Auch wenn es wünschenswert ist, halte ich es kaum für möglich, Spendenaufrufe - besonders von lokalen Akteuren - so weit zu koordinieren, dass ein abgestimmtes Handeln vor Ort möglich ist. Dafür sind zu viele Organisationen, Spontanbündnisse, Stiftungen und andere im Krisenfall aktiv, die aus der direkten Betroffenheit handeln. Umso wichtiger ist es, auf der Ebene der Diözesanverbände gemeinsam mit Caritas international Spendenaufrufe zu koordinieren. Zum Umgang mit Spenden gehört auch die Kommunikation mit den Spenderinnen und Spendern. Medienschaffende sind ungeduldig und drängen schon sehr bald nach Eintritt eines Katastrophenereignisses auf Antworten auf die Frage: "Was ist mit den Spendengeldern geschehen?" Außerdem - und das liegt auch im Interesse der Caritas - sollten wir direkt nach Eintritt des Ereignisses immer sensibilisiert bleiben für sogenannte "Stories of Hope": am Beispiel erzählen, wie die Caritas grundsätzlich für die Menschen wirksam ist.
 Alexander Knauf von der Caritas-Fluthilfe ging nach der Hochwasserkatastrophe in der Eifel von Tür zu Tür und bot Beratung für die Beantragung von Soforthilfe an.Foto: Philipp Spalek | Caritas international
Alexander Knauf von der Caritas-Fluthilfe ging nach der Hochwasserkatastrophe in der Eifel von Tür zu Tür und bot Beratung für die Beantragung von Soforthilfe an.Foto: Philipp Spalek | Caritas international
Der Umgang mit Geld
Der Umgang mit Geld ist in einer Krisensituation stellenweise heikel. So ist es zum Teil nicht möglich, die sonst üblichen technischen Hilfsmittel für die Verbuchung, Administration, Dokumentation, Belegführung etc. von Geldern anzuwenden. Dies bedeutet, dass es ein zuverlässiges, möglicherweise sogar analoges System geben muss, um hier Geldausgaben nachweisen und dokumentieren zu können. Ich hätte mir in der Fluthilfe eine schnellere Einigung auf die richtigen Formulare gewünscht.
Bürokratie versus schnelle Hilfe
Es wäre wünschenswert, wenn grundsätzliche Klärungen erfolgten, welche Höhe der Auszahlung aus Spendengeldern an Betroffene zu welchem Zweck unbedenklich ist. Die dahinterstehende Frage ist der Aspekt der Gemeinnützigkeit. Die Caritas als Wohlfahrtsorganisation ist an bestimmte Kriterien bei der Ausgabe von Spendenmitteln gebunden, um ihren Status als gemeinnützige Organisation zu halten. In der ersten Phase war keine hundertprozentige Klarheit erkennbar, welche Gelder in welcher Höhe für welche Fallkonstellationen verwendet werden dürfen und was davon steuerrechtlich - im Sinne der Mildtätigkeit - unbedenklich ist.
Der Baukasten der Fluthilfen, der sich auch in den zwei anderen großen Hochwasserereignissen bewährt hat, ist gut: Soforthilfen, Haushaltsbeihilfen, Härtefallhilfen, Wiederaufbau-Hilfe und technische Hilfen sowie Projekte, die der Nachsorge und der Stärkung des Sozialraumes dienen. Diese Systematik ist aus meiner Sicht - mehr oder weniger - übertragbar auch auf andere Katastrophenszenarien und Klimaereignisse. Sie sollte beibehalten werden.
Das Prinzip der Nachrangigkeit
 Caritas-Mitarbeitende verteilten in Solingen-Unterburg Lebensmittel und Hygieneartikel an einem Versorgungsstand.Foto: Caritasverband Wuppertal/Solingen
Caritas-Mitarbeitende verteilten in Solingen-Unterburg Lebensmittel und Hygieneartikel an einem Versorgungsstand.Foto: Caritasverband Wuppertal/Solingen
Das Prinzip der Nachrangigkeit ist Fluch und Segen zugleich. Es besagt, dass die Caritas erst dann Spendengelder an Betroffene auszahlen kann, wenn der Staat und Versicherungen ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Betroffenen nachgekommen sind. Das Prinzip ist absolut sinnvoll, hat aber zu Verzögerungen und damit auch zu Unmut bei den betroffenen Menschen geführt. Diese fordern - ganz zu Recht - ihren Teil von den immensen Spendengeldern, die nicht nur bei Caritas international, in den großen Spendenbündnissen sowie bei lokalen Spendenaufrufen eingegangen sind.
Verzögerungen
Ein Hemmnis in der Wiederaufbauhilfe war die äußerst schleppende Bearbeitung der Wiederaufbauhilfe-Anträge bei der Landesbank NRW. Diese sind für die Caritas aufgrund der Nachrangigkeit der Hilfen eine Grundvoraussetzung, um helfen zu können. Wichtig wäre es, hier eine schnellere Lösung bei der Bearbeitung zu finden. Außerdem könnte die Entwicklung eines Mechanismus helfen, der die Zahlung von Abschlägen an Betroffene erlaubt. In der Fluthilfe würde sich dies auf die Förderung des maximalen Eigenanteils von 20 Prozent bei der Wiederaufbauhilfe der Länder NRW und Rheinland-Pfalz beziehen. Dies würde Wartezeiten verkürzen. Der Knackpunkt dabei waren Bedenken, bei zu Unrecht ausgezahlten Mitteln an Betroffene Rückforderungen decken zu müssen.
Die Angst vor dem Finanzamt
Die Überprüfung der Bedürftigkeit Betroffener ist wichtig und auch die Transparenz bei der Verausgabung von Spendenmitteln. Diese Anforderung führt dazu, dass Caritas-Kolleginnen und -Kollegen vor Ort mehrseitige Anträge und Erhebungsbögen - gemeinsam mit den betroffenen Menschen - ausfüllen müssen. Dies hat gelegentlich zu einer bürokratischen Wahrnehmung der Hilfen durch die Betroffenen geführt.
Eine Kernfrage ist: Wie können wir den Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Angst nehmen, etwas falsch zu machen und bei einer etwaigen Prüfung mit Rückforderungen konfrontiert zu werden? Dieses Thema stellt auch Anforderungen an Geschäftsführende. Der ehemalige Fluthilfe-Koordinator der Diözese Passau, Mario Götz, sagt dazu sinngemäß: "Ich habe noch nie einen Finanzbeamten erlebt, der unsere Fluthilfen in Zweifel gezogen hätte und hier über Gebühr geprüft hätte."
 Das Wasser reichte bis zu den Deckenbalken der Wohnung dieser Familie in Solingen-Unterburg. Caritas-Mitarbeiterin Silvia Hamacher bot Hilfen an.Foto: Caritasverband Wuppertal/Solingen
Das Wasser reichte bis zu den Deckenbalken der Wohnung dieser Familie in Solingen-Unterburg. Caritas-Mitarbeiterin Silvia Hamacher bot Hilfen an.Foto: Caritasverband Wuppertal/Solingen
Ich plädiere für eine größere Ausgabenliberalität, ohne dabei ins Robin-Hood-Hafte abzugleiten. Die Phoenix-Datenbank ist ein hilfreiches Instrument, um Doppel- und Mehrfachförderungen auszuschließen. Hilfreich wäre auch mehr Klarheit in Bezug auf Ermessensspielräume bei der Förderung Einzelner. Förderentscheidungen vor Ort sollten komplett im 4-Augen-Prinzip oder von einer lokalen Vergabekommission getroffen werden dürfen.
Die Entwicklung langfristiger Hilfen: Nachsorge und Sozialraumprojekte
Die Caritas ist keine klassische "Blaulicht"-Organisation, wie etwa die Malteser. Die Stärke der Caritas liegt zum einen in der Langfristigkeit ihrer Hilfen. Die Caritas ist auch dann oft noch da, wenn andere Organisationen längst ab- oder weitergezogen sind. Zum anderen sind Caritas-Mitarbeitende Expertinnen und Experten in der psychosozialen Begleitung. Das haben unsere Kolleginnen und Kollegen während der Fluthilfe eindrücklich bewiesen. Entwicklungspotenzial sehe ich in der Ideenfindung für Projekte der Nachsorge und im Sozialraum. Nicht jeder ist stark in der kreativen Entwicklung von Projekten, die schnell und unkonventionell den Menschen helfen. Hier könnte es klug sein, Kreativmethoden schon in Nicht-Krisenzeiten einzuüben, um im Krisenfall - nach der ersten Phase der akuten Hilfen - Projekte zu entwickeln, die langfristig und nachhaltig wirken.
Christoph Grätz
Von Strukturen lösen
 Martin Jost ist Vorstandsvorsitzender beim Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V.Foto: Caritas Euskirchen
Martin Jost ist Vorstandsvorsitzender beim Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V.Foto: Caritas Euskirchen
Auch 18 Monate nach der Flutnacht vom 14. Juli spüren wir in Euskirchen noch die Auswirkungen der Katastrophe. Die Sanierung unserer betroffenen Dienste und Einrichtungen ist nicht abgeschlossen, an einigen Gebäuden laufen die Arbeiten weiter auf Hochtouren.
Rückblickend kann ich sagen, dass besonders die ersten Wochen nach der Flut für uns lehrreich waren. In der Akutphase standen wir vor sehr vielen Herausforderungen, die wir gleichzeitig und schnell lösen mussten. Das ging nur, indem wir uns von Strukturen gelöst haben. Wir haben geschaut: Was funktioniert, wo können wir Dienste unterbringen, wer kann wo helfen? Diese Flexibilität hat es uns ermöglicht, die Versorgung aller unserer Klienten nahtlos zu gewährleisten und schnell in die Soforthilfe für die Bevölkerung einzusteigen.
Daneben sind Krisenmanagement und Vorsorge in den Fokus gerückt. Vorräte an haltbaren Lebensmitteln sowie Verbrauchs- und Hygienematerial anlegen etwa. Das ist alles nicht neu, aber in den letzten, gefühlt sehr sicheren Jahrzehnten etwas in den Hintergrund gerückt. Denn nach der Krise ist vor der Krise, und der Winter steht erst noch vor der Tür mit all seinen Unwägbarkeiten, was die Energieversorgung angeht. Auf der menschlichen Seite nehme ich aus der Flutkatastrophe zwei Dinge mit: Solidarität tut gut und Geduld hilft.
Martin Jost