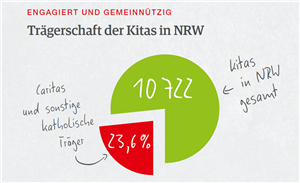Caritas in NRW: Welche Themen beschäftigen die Suchthi
 Angelika Schels-Bernards ist Referentin für Sucht- und Aidshilfe beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln und Sprecherin der Fachgruppe Sucht und Aids der Caritas in NRW.Foto: Martin Karski
Angelika Schels-Bernards ist Referentin für Sucht- und Aidshilfe beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln und Sprecherin der Fachgruppe Sucht und Aids der Caritas in NRW.Foto: Martin Karski
lfe in der Caritas derzeit am meisten?
Angelika Schels-Bernards: Neben den Dauerbrennern wie Alkohol, pathologischem Glücksspiel und Cannabis sehen sich die Beratungsstellen und Fachkliniken der Caritas in unserem Bundesland aktuell mit einem deutlichen Wandel der Konsummuster konfrontiert. Die Rede ist hier von einer problematischen Ausweitung des Crackkonsums, die mit einer deutlichen - und deutlich sichtbaren - Verelendung der Menschen einhergeht.
Dieser Wandel der Konsummuster muss auch zusammen mit der hohen Zahl der Drogentodesfälle gelesen werden. 2023 sind laut Angaben des Innenministeriums 872 Menschen gestorben, das sind 169 mehr als 2022 und mehr als doppelt so viele wie noch 2020.
Auch Beratung zu internetbezogenen Störungen wie etwa Online-Glücksspiel, Computerspiel, aber auch zunehmend Pornografie-Nutzungsstörungen werden in den Beratungsstellen von Caritas, SKM und SKFM vermehrt nachgefragt.
Und daneben beschäftigt uns alle natürlich das neue Cannabisgesetz.
Caritas in NRW: Mit dem Cannabisgesetz (kurz: CanG) hat der Bundestag den privaten Eigenanbau von Cannabis durch Erwachsene zum Eigenkonsum sowie sogenannte Anbauvereinigungen legalisiert. Ziel ist es, zu einem verbesserten Gesundheitsschutz beizutragen, die cannabisbezogene Aufklärung und Prävention zu stärken, die organisierte Drogenkriminalität einzudämmen sowie den Kinder- und Jugendschutz zu stärken. Wie steht die Caritas dazu?
Angelika Schels-Bernards: Grundsätzlich begrüßt die Caritas die Teillegalisierung. In den letzten Jahren war zu beobachten, dass gerade junge Cannabiskonsument*innen durch hochpotente Substanzen psychisch erkranken. Solche Substanzen waren entweder mit sehr hohem THC-Gehalt gezüchtet oder aber mit synthetischen Cannabinoiden versetzt. Das hat dann Psychosen ausgelöst, die das ganze Leben lang bleiben. Durch eine Teillegalisierung können sich Konsument*innen besser darüber informieren, was genau sie denn konsumieren. In den Caritas-Beratungsstellen wird es zukünftig mehr um die Vermittlung von Konsumkompetenz und kontrolliertem Konsum gehen.
Gleichwohl sehen wir hier bei der Umsetzung auf Bundes- und Landesebene noch Handlungsbedarf in einer Reihe von Fragen, damit es zu guten und tragfähigen Lösungen kommt. Das betrifft zum einen die Schaffung von Rechtssicherheit in verschiedenen Bereichen, wie etwa der Teilnahme am Straßenverkehr, aber auch den Ausbau von Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten und der Prävention. Es steht zu erwarten, dass die Zahl der Erstkonsument*innen erst einmal ansteigt; da sollten Angebote vorgehalten werden, um die Entstehung einer Abhängigkeitsstörung zu verhindern.
 "Wir sind in NRW mit einem Wandel der Konsummuster konfrontiert."Foto: Africa Studio | Adobe Stock
"Wir sind in NRW mit einem Wandel der Konsummuster konfrontiert."Foto: Africa Studio | Adobe Stock
Caritas in NRW: Wie kann die Prävention - insbesondere für Kinder und Jugendliche - verbessert und gestärkt werden?
Angelika Schels-Bernards: Gerade der Konsum im häuslichen Umfeld führt nicht selten dazu, dass Kinder in eine Substanzkonsumstörung sozusagen hineinsozialisiert werden. Es ist wichtig, Eltern dafür zu sensibilisieren und aufzuklären. Auch muss darüber aufgeklärt werden, dass es Aufgabe der Eltern ist, dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche nicht konsumieren. Cannabiskonsum ist für Kinder und Jugendliche weiterhin nicht legal.
Wichtig ist, dass Präventionsangebote vor Ort durchgeführt werden. Also dass die Präventionsfachkräfte der Caritas-Beratungsstellen in die Schulen und Einrichtungen der offenen Jugendarbeit gehen und dort über Risiken des Konsums aufklären.
Nur auf bundesweite Kampagnen zu setzen, reicht keinesfalls aus - Jugendliche suchen nicht nach Präventionsangeboten im Internet.
Caritas in NRW: Um Jugendliche zu erreichen, braucht es mehr als Flyer und eine Website. Geschieht genug?
Angelika Schels-Bernards: Man muss die Jugendlichen ernst nehmen. Eigentlich ist es ja ganz normal, dass junge Menschen auch neugierig sind, Rauscherfahrung zu machen. Das bedeutet, dass es tatsächlich nicht reicht, ihnen Flyer in die Hand zu drücken. Sie haben viele Fragen und brauchen qualifizierte und keine moralischen Antworten, damit sie ggf. Konsumkompetenz erlangen.
Es ist gut und wichtig, die Plätze vor Ort zu kennen, wo Jugendliche sich treffen, feiern gehen - und dort Angebote zum Safer Use - also zu sicherem Konsum - zu geben. Auch Angebote des Drug-Checkings haben übrigens eine gute präventive Wirkung. Modellprojekte haben gezeigt, dass Jugendliche vorsichtiger konsumieren, wenn sie wissen, dass Substanzen nicht in Ordnung sind, also gefährliche Beimischungen haben.
Caritas in NRW: Es gibt verschiedene digitale Plattformen, die sich direkt an Neugierige, Konsument*innen, Suchtkranke und Angehörige richten. Wie beurteilen die Suchtexpert*innen der Caritas angesichts der aktuellen Geschwindigkeit der digitalen Transformation diese Angebote?
Angelika Schels-Bernards: Die Caritas bietet ja bereits seit über 15 Jahren Onlineberatung an. Von daher ist das für unsere Berater*innen erst einmal nichts Neues. Mit der DigiSuchtplattform haben wir seit einem guten Jahr ein zeitgemäßes Instrument, mit dem wir mehr Menschen mit unseren Beratungsangeboten erreichen. Denken wir etwa an den ländlichen Raum, wo nicht allerorts Beratungsstellen vorhanden sind, oder an Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Das ist eine sehr gute Sache. Viele Menschen, die einen problematischen Substanzkonsum haben oder schon suchtkrank sind, schämen sich, Hilfe zu suchen. Sucht ist immer noch ein Tabuthema und ein sehr schambehaftetes Thema. Menschen fällt es manchmal leichter, erst einmal über die Onlineberatung in einen Beratungsprozess einzusteigen.
Vielen Menschen ist gar nicht bekannt, dass sie auf Wunsch auch anonym und ohne Kosten Suchtberatung in Anspruch nehmen können. Das sollte man stärker bekannt machen und diese Angebote auch bewerben. Je früher Menschen zur Suchtberatung gehen, desto besser ist ihre Prognose, die Sucht zu überwinden.
 Die Entkriminalisierung von Cannabis zieht eine Vielzahl ungelöster Fragen nach sich.Foto: 24K-Production | Adobe Stock
Die Entkriminalisierung von Cannabis zieht eine Vielzahl ungelöster Fragen nach sich.Foto: 24K-Production | Adobe Stock
Caritas in NRW: Was müsste sich an den politischen Rahmenbedingungen in NRW ändern, um die Suchthilfe (und Prävention) effektiver zu machen?
Angelika Schels-Bernards: Die Suchtberatung ist in NRW immer noch eine freiwillige Leistung der Kommunen. Das bedeutet, dass sie, was die Finanzierung angeht, sozusagen von der Hand in den Mund lebt. Die Landesmittel zur Finanzierung der Suchthilfe werden seit der Kommunalisierung im Jahr 2009 jährlich überrollt. Das liegt vollkommen quer zu den stetig steigenden Kosten für die umgebende Infrastruktur und das Personal und zu dem wachsenden Bedarf. Hier brauchen wir dringend eine Dynamisierung oder Anpassung der Refinanzierung.
Wir stehen aktuell vor riesigen Herausforderungen: die Senkung der großen Zahl der Drogentodesfälle, die Kokain- und Crackwelle, die zunehmende Verbreitung synthetischer Opioide, die Teillegalisierung von Cannabis - da muss die Suchtberatung in eine Pflichtleistung der kommunalen Daseinsvorsorge überführt werden oder etwa in einem eigenen Gesetz geregelt werden, wie es die DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) vorgeschlagen hat.
Suchtberatung spart volkswirtschaftlich hohe Kosten ein, das findet leider viel zu wenig Beachtung. Eine Studie aus Bayern errechnet Einsparungen von gesellschaftlichen Kosten um den Faktor 17 gegenüber den eingesetzten Finanzmitteln.
In einer Simulationsrechnung für das Jahr 2019 weist das einen monetären Effekt in Höhe von gut 474 Millionen Euro an vermiedenen gesellschaftlichen Folgekosten durch die ambulante Suchtberatung allein in Bayern aus.
Caritas in NRW: Wer wachen Auges durch die Innenstädte geht, bemerkt häufig eine größere Verelendung von Menschen, die offensichtlich auch alkohol- und drogenkrank sind. Worauf ist das zurückzuführen?
Angelika Schels-Bernards: Es sind verschiedene Faktoren. Zum einen beobachten wir einen ausgeprägten Wandel der Konsummuster. In NRW haben wir es aktuell mit einem enormen Zuwachs an Crackkonsum zu tun. Das zeigen Zahlen in Drogenkonsumräumen, wo sich die Zahl der Konsumvorgänge exorbitant erhöht hat. Crack und Freebase sind feststoffliche Mischungen aus dem Salz des Kokains und Natron bzw. Ammoniak. Der Name "Crack" stammt von dem knackenden Geräusch, das die Körnchen beim Verbrennen machen. Crack und Freebase gehören zu den am schnellsten abhängig machenden Substanzen. Die Beschaffung und der Konsum bestimmen den ganzen Tagesablauf und schädigen den Körper ungemein. Um den Anstieg zu verdeutlichen: Wurden im Jahr 2016 im Düsseldorfer Drogenkonsumraum 210 Konsumvorgänge mit Crack verzeichnet, waren es bis Ende Juli 2023 bereits 19 500. Wir beobachten eine Vielzahl von kurz-, mittel- und langfristigen Folgen, die größtenteils zusammenhängen. Diese reichten von einer katastrophalen körperlichen Verfassung (vor allem auch gekennzeichnet von Unterernährung und Schlafmangel) über Verhaltensauffälligkeiten (besonders stechen hier das Aggressionspotenzial sowie eine hohe Agitiertheit bzw. ein "Getriebensein" hervor), über neurologische und psychische Erkrankungen bis hin zu entsprechenden Auswirkungen auf das Sozialleben.
Von den steigenden Mieten in den Großstädten sind natürlich auch suchtkranke Menschen betroffen, die dann zunehmend auf der Straße leben. Es zeigt sich ein Trend, dass Suchtberatungsstellen, Kontaktläden mit Überlebenshilfen usw. in der Städteplanung nicht mitgedacht werden, weil niemand Suchtkranke in der Nachbarschaft haben will. Wenn diese Einrichtungen aber aus den Zentren verdrängt werden, besteht die Gefahr, dass die Menschen nicht erreicht werden.
 Das Angebot an pornografischem Material im Internet ist gewaltig, voller Vielfalt und neuer Varianten, und es ist jederzeit abrufbar. Caritas-Beratungsstellen berichten seit geraumer Zeit von Betroffenen mit exzessiver Pornosucht. Die Symptome ähneln der Alkoholsucht.Foto: M-Production | Adobe Stock
Das Angebot an pornografischem Material im Internet ist gewaltig, voller Vielfalt und neuer Varianten, und es ist jederzeit abrufbar. Caritas-Beratungsstellen berichten seit geraumer Zeit von Betroffenen mit exzessiver Pornosucht. Die Symptome ähneln der Alkoholsucht.Foto: M-Production | Adobe Stock
Caritas in NRW: Wie wird darauf reagiert - und was müsste aus Sicht der Suchthilfe eigentlich noch passieren?
Angelika Schels-Bernards: Die Beratungsstellen und Träger von Drogenkonsumräumen haben teilweise bereits reagiert, indem sie ihre Öffnungszeiten ausgeweitet haben. Durch eine sichere Umgebung kann man dafür sorgen, dass es nicht zu Folgeschäden kommt. Nicht selten infizieren sich drogengebrauchende Menschen durch die Weitergabe oder Mehrfachverwendung von Konsumutensilien mit Hepatitis oder HIV. Auch über geteilte Crackpfeifen können sich Menschen mit Hepatitis infizieren. In den Drogenkonsumräumen besteht auch immer die Möglichkeit, Beratung und Überlebenshilfen in Anspruch zu nehmen. Tatsächlich werden diese Angebote verstärkt in Anspruch genommen.
Viele Beratungsstellen haben ihre aufsuchende Arbeit auf der Straße ausgeweitet, um die Menschen besser zu erreichen. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen viel mehr niedrigschwellige Angebote, um den Menschen helfen zu können. Also mehr Kontaktläden als informelle Anlaufstellen, in denen auch Überlebenshilfen bereitgestellt werden, mehr Konsumplätze und die dazugehörigen Materialien, wie Spritzensets, Inhalationsutensilien und - wie beim Crack - auch Utensilien, die beispielsweise vor Verbrennungen schützen. Dazu Angebote zum Drug-Checking, um Notfälle durch gefährliche Beimischungen in Substanzen zu verhindern. Die Caritas in NRW hat bereits mehrfach den Ausbau solcher niedrigschwelligen Angebote gefordert; diese müssen natürlich dann auch finanziert werden.
Ein Bild mag dies verdeutlichen: Suchtarbeit ist wie ein Wasserposten beim Marathonlauf: Manche laufen einfach daran vorbei, andere schnappen sich den Becher und gießen sich das Wasser über den Kopf, wieder andere nehmen den Becher und trinken daraus. Worauf es ankommt, ist, dass man dort steht und den Becher anbietet.
Caritas in NRW: Die große Volksdroge Alkohol ist gesellschaftlich weitgehend akzeptiert. Wie sehen hier die Konsummuster und die Gefährdungen aus?
Angelika Schels-Bernards: Alkohol ist immer noch die Nummer 1 in den Suchtberatungsstellen der Caritas. Durch den Umstand, dass Alkohol gesellschaftlich akzeptiert ist, kommen Menschen, die ihren Alkoholkonsum nicht mehr kontrollieren können, erst relativ spät in die Suchtberatungsstellen. Vielen macht der Gedanke an Abstinenz auch große Angst. Die Sorge, an gesellschaftlichen Events nicht mehr trinkend teilnehmen zu können treibt diese Menschen ungemein um. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass Menschen, die keinen Alkohol trinken immer in einen Rechtfertigungszwang kommen.
Die Caritasberatungsstellen halten aber auch Angebote zur Konsumreduktion vor, das heißt, dass Menschen hier auch lernen können (wieder) kontrolliert zu trinken.
Caritas in NRW: Wie funktionieren Prävention und Suchthilfe bei dieser legalen Droge?
Angelika Schels-Bernards: Suchtberatungsstellen sind nicht nur für sogenannte harte Drogen zuständig, sondern beraten auch bei Alkoholproblemen oder Medikamentenabhängigkeit. Das heißt, das Angebot steht für jeden und jede offen, egal ob man selbst betroffen ist oder als Angehörige mit betroffen ist.
Die meisten Beratungsstellen halten hier auch Angebote für Kinder suchtkranker Eltern vor. Das ist in Hinblick auf Prävention besonders wichtig, damit diese Kinder nicht selbst eine Abhängigkeitserkrankung entwickeln.
Prävention in den Schulen adressiert ebenfalls Alkohol, statt Abstinenz geht es hier auch um Konsumkompetenz. Das bedeutet, dass gerade auch junge Menschen erkennen, wo ihr Limit ist.
Im Mittelpunkt der sogenannten Frühinterventionsprogramme wie beispielsweise SKOLL steht nicht die Abstinenz, sondern die Auseinandersetzung mit der eigenen. Einen guten Effekt haben hier auch Ex-Gebraucher, die von ihrem Weg in die Abhängigkeit berichten.
Caritas in NRW: Wie haben sich die Konsummuster in der Coronazeit verändert?
Angelika Schels-Bernards: Die Befunde deuten darauf hin, dass der Alkoholkonsum von Jugendlichen als auch jungen Erwachsenen in der Pandemie zurückging, gleichzeitig der Zigaretten- und Cannabiskonsum sowie die Mediennutzung anstieg.
Beim Alkoholkonsum war darüber hinaus zu beobachten, dass Phasen der Pandemie, die mit starken Einschränkungen des Alltags einhergingen, den Konsum der Jugendlichen ausbremsten. Diejenigen, die im häuslichen Umfeld ohnehin bereits viel getrunken haben, taten das auch weiterhin.
In Phasen mit strikten Infektionsschutzmaßnahmen zeigte sich bei jungen Erwachsenen ein Rückgang des Alkoholkonsums, der in Phasen mit Lockerungen wieder auf vorpandemisches Niveau anstieg. Durch die Schließung gastronomischer Betriebe etwa, ging gerade das exzessive Trinken (Bingedrinking) zurück.
Am deutlichsten schlugen sich in den Beratungsstellen die internetbezogenen Störungen nieder. Hier waren es gerade Menschen mit Computerspielproblematik, aber mehr noch die problematische Nutzung von Datingapps oder Internetpornografie, wegen denen Menschen Beratung und Behandlung nachfragten.
Caritas in NRW: Gilt das für alle unterschiedlichen Drogen?
Angelika Schels-Bernards: Allen Substanzen oder exzessiven Verhalten haben gemeinsam, dass sie konsumiert oder ausgeführt werden, um sich gerade in Krisenerleben von negativen Gefühlszuständen zu entlasten oder Sorgen und Nöte einfach im Rauschzustand auszublenden.
Caritas in NRW: Was beobachten die Suchtberatungsstellen der Caritas im Hinblick auf Mode-Rauschmittel - wie z. B Lachgas - bei Jugendlichen?
Angelika Schels-Bernards: Es besteht aktuell große Unsicherheit. Vor allem wenden sich besorgte Eltern und andere Erziehende an die Beratungsstellen, um sich über die Gefahren zu informieren.
Dies ist dem Umstand einer deutlichen Zunahme des Konsums geschuldet. Man sieht bspw. in der Umgebung von Kiosken oder sogenannten Partyzonen haufenweise Gaspatronen, Kartuschen und Ballons. Auch auf Festivals oder anderen Events gehört es inzwischen zum Guten Ton eine Lachgas-Ballon-Bar vorzuhalten.
Die gute Nachricht: Lachgas macht nicht auf körperlicher Ebene abhängig. Doch kann es zu schwerwiegenden Langzeitfolgen wie Schädigungen des Nervensystems und Psychosen kommen. Es handelt sich hierbei um eine gefährliche Partydroge, die in Großbritannien und in den Niederlanden bereits verboten ist.
Caritas in NRW: Suchthilfe umfasst mehr als Prävention, Beratung und Rehabilitation bei stoffgebundenen Rauschmitteln. Wie können Hilfsangebote auf andere und auch neue Herausforderungen reagieren, z. B. Spielsucht, Internetsucht, Pornosucht, Tiktok, …?
Angelika Schels-Bernards: Zunächst einmal ist es wichtig die Entwicklungen im Blick zu halten. Also, wo tauchen neue Substanzen auf, wo bilden sich neuartige Konsummuster heraus, wie verändern sich Szenen, die Zahl der Drogentodesfälle- und die Ursachen…
Dies geschieht einerseits durch die Anfragen der Ratsuchenden und andererseits durch die deutsche und internationale Suchtforschung oder das Monitoring durch Organisationen, wie bspw. die Suchtkooperation NRW.
Das bedeutet aber auch, dass sich die Mitarbeitenden der Suchtberatungs- und Behandlungsstellen permanent in Weiterbildung befinden, das heißt man muss sich permanent darüber informieren, was ist gerade dran und welche Bedarfe ergeben sich daraus.
Besonders herausfordernd ist das bei den internetbezogenen Störungen, da der Konsum ja meist im privaten Raum stattfindet und sich darüber hinaus nur in Studien oder Beratungsnachfragen abbildet.
Einige Dinge bei der Suchtentstehung sind eigentlich immer gleich: also die neurobiologischen Prozesse etwa. Und dennoch werden sehr unterschiedliche Erlebnispotenziale angesprochen, die für die Behandlung aber evident sind. Diese dann auf die Lebenswelten der Betroffenen zu beziehen, macht Suchtarbeit aus.
Um sich hier "fit zu halten", also die Sichtung von Fachliteratur, die fachliche Weiterbildung, also die Aneignung von Wissen und Methodenkompetenz erweisen sich in gewisser Weise als janusköpfiges Konstrukt - das leisten die Suchtberater_innen in Zeiten knapper zeitlicher und finanzieller Ressourcen zusätzlich zu ihrer Arbeit im Feld, gleichzeitig macht es die Suchtarbeit aber auch zu einem so spannenden Arbeitsfeld. Suchtarbeit ist Fleißarbeit.
Fragen von Markus Lahrmann